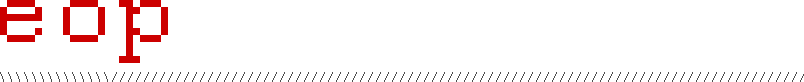“Die Sache selbst wird durch das Nahetreten etwas zeigen”
Interview von Sylvia Wendrock mit Esther Dischereit zu ihrer Tonspur “Partikel vom großgesichtigen Kind” im Wiener Museumsquartier
Foto© Bettina Straub  “Esther Dischereit spricht an, wo weggeschaut wird, und vermag es, die Sprache ihrer Ohnmacht zu berauben. Mittels versprengter dokumentarischer Floskeln in irritierender Bezugsnähe zur Poesie wird Lektüre zu einer räumlichen Erfahrung.”
“Esther Dischereit spricht an, wo weggeschaut wird, und vermag es, die Sprache ihrer Ohnmacht zu berauben. Mittels versprengter dokumentarischer Floskeln in irritierender Bezugsnähe zur Poesie wird Lektüre zu einer räumlichen Erfahrung.”
“Im Interview aber raubt die Professorin für Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst vor allem eines: Unmündigkeit.”
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen “Partikel vom Großgesichtigen Kind” und der TONSPUR 63 beim „MQ Summer of Sounds“?
Diese Arbeit ist im Zusammenhang meiner Beschäftigung mit Jean-Martin Charcot, dem Hôpital de la Salpêtrière in Paris und anderen Psychatrien entstanden. Ich stellte fest, dass der Begriff der Hysterie verschwunden ist und verschiedenen neurotischen Störungen Platz gemacht hat. Ich stellte auch fest, dass die Behandlung von Kranken mit Elektroschocks eine Renaissance erfahren hat. Diese literarische Arbeit vollendete ich nicht. Als ich mit Stefanie Hoster, die die Regiearbeit übernahm, über TONSPUR 63 sprach, schlug sie sofort eine Bearbeitung dieses Textes vor. Mit ihr verbindet mich eine langjährige Zusammenarbeit. Dieses Kind in den langen Gängen… Es ist ja nicht nur im MuseumsQuartier so, dass Wien mit seinen Bauten außerordentlich martialisch erscheint. Es beherbergt eine Fülle von historischen Monumentalgebäuden. Demonstrationen der Macht. Als ich die TONSPUR_passage sah, waren mir auch hier diese undurchdringlichen, sich abschottenden Mauern gegenwärtig, und darauf nimmt meine Arbeit Bezug. Es scheint mir eine merkwürdige Verehrung zugleich des Verrückten und des Outcast zu geben. Diese Gebäude, dieses sich Abschließende und das Verrückte, das wollte ich zusammenbringen.
Mir erwuchs beim Hören des Loops die Assoziation zum Otto-Wagner-Spital in den Steinhofer Gründen Wiens, dessen Gebäude so eigenartig geschmückt und dekorativ wirken und wo Tafeln aufgestellt sind, die gleichzeitig von schwersten Verbrechen in der Vergangenheit und psychischen Krankheiten erzählen…
Ich ging einmal dort spazieren, wo auch Thomas Bernhard in pulmologischer Behandlung war. Das besonders in intellektuellen und künstlerischen Kreisen gelegentlich als subversiv angesehene Verrücktsein, das ja auch Leiden und Ausschluss bedeutet, hat mich dabei bewegt. Diese beiden Momente: das Habsburgerisch-Prunkvolle der abgeschlossenen Gebäude und das Prächtige der Psychatrien, die Elend einschließen und verbergen, und gleichzeitig ist alles recht ordentlich und sauber… Im MuseumsQuartier sind diese beiden Komponenten zusammengebracht worden: Es ist ein Platz entstanden, auf dem sich die Leute gerne aufhalten, manchmal bewohnen sie den Platz regelrecht, als sei er ihr Zimmer. Er wird als einer der wenigen Räume aufgefasst, von denen man den Eindruck haben könnte, sie gehörten den Bürgern. Aber die Gebäude sind so martialisch geblieben und haben vor allem in ihren Ausläufern diese Unzugänglichkeit oder Sprödigkeit bewahrt.
Beziehen Sie das Hörstück also auch auf das MuseumsQuartier selbst?
Die Texte der Installation beziehen sich nicht im Besonderen auf Wien, sie nehmen Bezug auf die Wirkung überkommener monumentaler Demonstrationen. Jean Szymczak (Ton) und Stefanie Hoster (Regie) sind diesem Gedanken gefolgt und haben die 8-Kanäle, die zur Verfügung stehen, so belegt, dass Text, Klang und Geräusche diesem Raum-„Sehen“ folgen.
Das MuseumsQuartier ist, wenn es an Sommerabenden frequentiert wird, wie eine exterritoriale Enklave, wo kurzfristig die Freiheit ausgebrochen ist, aber beispielsweise im Zusammenhang mit dem Akademikerball sieht man die Dinge dann schnell anders: dieses zähe Fortbestehen von Hierarchien und Klassenverhältnissen. Einige Vertreter der Justiz erinnerten mich an Zeiten, von denen einst Honoré de Balzac geschrieben hat. Ob ich das wollte oder nicht, drängte sich Vergangenheit in diese Arbeit.
Zur Klangarbeit: Sie schaffen nicht allein Literatur, sondern arbeiten sie zu Klanginstallationen aus, verarbeiten also Ihre Texte selbst schon mit anderen Künsten, anderen Medien. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich habe Ende der 80er Jahre angefangen mit Musikern zusammen zu arbeiten. Mir war die Sprache eng geworden, ich wollte über sie hinausgehen können und glaubte, diese Möglichkeit in der Musik zu finden. Dann habe ich das Label “word music” gegründet, das bis heute zusammen mit dem Percussionisten Ray Kaczynski besteht. Ab ungefähr dem Jahr 2000 hatte ich das Glück, mehrere Jahre Konzeptkunst kuratieren zu dürfen. Das Denken und die Arbeitsweise von Konzeptkünstlerinnen und Konzeptkünstlern haben großen Eindruck auf mich gemacht. Ich begann mich mit der Frage zu beschäftigen, was dieses konzeptuelle Denken für mich literarisch bedeuten könnte. Meine erste umfassendere Arbeit in dieser Richtung entstand – von Projekten wie einem mit einem Gedicht bespielten Bürohochhaus abgesehen – in Dülmen, einer Stadt in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt Dülmen hatte einen Wettbewerb ausgeschrieben zur Ehrung der jüdischen Bürgerinnen und Bürger und ihrer Verdienste in der Region, also etwas ganz anderes als ein Shoa-Denkmal. Es war in Deutschland ziemlich einmalig, auf diese Weise an die vormalige Existenz des jüdischen Nachbarn zu erinnern. Ich fand die Richtung dieses Vorhabens sehr wichtig; sie entsprach einer Diskussion, die immer wieder geführt worden ist: nämlich die jüdischen Bürgerinnen und Bürger zu ehren, so wie sie gelebt und gearbeitet haben. Meine Wettbewerbsbeteiligung bestand in einem invisiblen Denkmal. Es ging um einen bestimmten Platz, den die Stadt in diesem Zusammenhang umbenennen wollte und der von den Leuten stark genutzt wird. Ich konnte nicht behaupten, dass ich den Platz sehr attraktiv gefunden hätte – die TONSPUR_passage finde ich jetzt auch nicht besonders schön -, aber ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Leute den Platz nutzen, benutzen, dort leben. Wie kommt also mitten in dieses bereits stattfindende Bewohnen die Erinnerung hinein – wo sollte der Raum für vormaliges jüdisches Leben sein? Ich wollte keinerlei Edukationsmaßnahmen, ich wollte nicht lehren oder jemanden belehren; ich wollte nichts weiter als darstellen, wie es ist, wenn jemand da war und verschwunden ist. Was ist dann noch da? Trotzdem da. An einer Stelle, – wo jedermann sitzen kann; die also im öffentlichen Raum und frei zugänglich ist, ohne dass man dafür bezahlt -, habe ich eine Soundinstallation von 55 Tracks installiert, die nur ausgelöst wird, wenn man entweder gewusst hat, dass sie da ist, oder wenn man sie durch Zufall entdeckt. Wenn es einem nicht gefällt und man nicht mehr zuhören will, kann man sich einen Platz weiter weg hinsetzen und hört schon nichts mehr. Außerdem endet jede Sequenz nach spätestens drei Minuten. An einem zweiten Tonträger – diesmal hoch über dem Platz gelegen – hatte ich 36 Klangzeichen platziert, von denen jeweils eines einmal am Tag zwischen 8 und 20 Uhr ohne Angabe der genauen Uhrzeit eine Minute lang zu hören ist. Rezepte aus einem österreichisch-jüdischen Kochbuch, übrigens. Es walten also Zufall und Willkür. Damit habe ich diese Eigenart der Erinnerung transponiert, Menschen zu befallen oder zu überfallen, ohne dass sie darum gebeten hätten. Das ist wie eine Art von alltäglichem Beschäftigtsein mit Gästen – gleichgültig, ob sie hereingebeten würden oder nicht. Der Wiener Dieter Kaufmann komponierte Klänge und Geräusche, die den Ort mit “aufnahmen“; die Musik konnte auch eigenständig auftreten. Durch diese Arbeiten und natürlich auch durch meine Hörwerke, die insbesondere für Deutschlandradio Kultur entstanden, konnte ich mich ausbilden. Das ist der Hintergrund, warum mich die TONSPUR_passage in Wien interessierte. Als ich die 7-teiligen Kästen sah, die in der Passage angebracht sind, war mir sofort klar, dass ich auch mit einem Konzeptkünstler zusammenkommen wollte. Ich fragte den paper artist Riccardo Ajossa aus Rom. Mit ihm hatte ich auf der Biennale in Venedig einmal zusammen in seinem Workshop gearbeitet. Diese Kästen werden nicht immer als dazugehörig aufgefasst. Sie machen einen eher unstrukturierten Eindruck oder werden für Werbezwecke genutzt. Ich wollte aber, dass man gleichsam eintritt. Ich wollte, dass die Passage auch als Raum zu begreifen ist, in dem ich verweilen könnte. Sie ist immerhin überdacht, man ist vor Regen geschützt. Flüchtig, sicher.
Woher kommt die Musik zu Ihren Texten. Ist diese dann in Ihrer Vorstellung oder in der des engagierten Musikers?
Die Tonalität des Geschriebenen ist für mich immer schon Musik, besonders wenn es sich um lyrische Texte handelt. Als ich einmal ein Stück über Leute schrieb, die ziemlich schwer zu ihrem Lebensunterhalt kamen, wenn überhaupt, musste ich unbedingt Leonard Bernsteins „Candide“ hören. Oder Tom Waits, als ich „Blumen für Otello. Über die Verbrechen von Jena“ schrieb.
Wenn Text und Musik miteinander verschränkt werden, habe ich manchmal ziemlich vage, undeutliche Vorstellungen. Im anderen Fall wieder weiß ich ganz genau, dass es ein Sprecher sein muss, der mit einem schweren amerikanischen Akzent redet wie in Dülmen. Häufig überrascht mich die Auffassung des Anderen vollkommen, es ist dann auch nicht mehr „mein“ Stück. Es ist etwas neues Anderes geworden.
Für die Installation folgte ich dem Vorschlag der Regie; ich lernte Frank Wingold erst kurz vor der Produktion kennen. Er hätte es mir auch nicht sagen können, was er macht. Seine Arbeit entstand ganz und gar aus dem Augenblick. Er hatte gelesen und verließ sich dann vollständig auf sein Instrument: diese unbeschreibliche Gitarre. Ich finde es gut, mit Musikerinnen oder Musikern zusammenzuarbeiten, die sehr selbstständig sein können. Im Ergebnis werde ich von meinen eigenen Stücken überrascht. Oder muss mich an sie gewöhnen. Dieses Hinzutreten der anderen Künste empfinde ich als einen Vorgang, mit dem die Stücke gewissermaßen vervollständigt werden. Oft werden Ideen eingebracht, die ich niemals gehabt hätte – so sehr glaube ich daran, dass der Text und nur der Text ausreichend sei und ich alles gesagt hätte. Ich könnte für jemand anderen einen Part wie Regie vielleicht übernehmen, aber nicht für meine eigenen Stücke. Da fehlt mir die Distanz.
Also führten Sie bei Ihren Klangstücken, wie z.B. dem Hörspiel „Blumen für Otello – Über die Verbrechen von Jena“ nicht die Regie?
„Blumen für Otello“ ist ein Libretto oder musiktheatrales Werk. Es wurde als Hörstück von Deutschlandradio Kultur bereits produziert und ist online hörbar (eingereicht für den ARD-Hörspielpreis, ein Wettbewerb, der im November entschieden wird). Für die Regie ist Giuseppe Maio verantwortlich. Die Regie mache ich niemals selbst, ich treffe ich mich mit den Regisseuren, meist auf deren Anfragen hin. Wenn eine personelle Entscheidung einmal getroffen ist, dann ist für mich damit eine Gewissheit darüber verbunden, dass diese Person weder das Werk zerstören noch es in einer völlig „falschen“ Weise – sofern es da falsch und richtig überhaupt geben kann – interpretieren wird. Dann kommt die Handschrift des anderen Künstlers oder der Künstlerin zum Tragen, die das Werk eben selbständig auffasst. Ich weiß ja, wie z.B. Stefanie Hoster als Dramaturgin und Regisseurin mit meinen Texten umgeht. Sie hat zu den Texten, die sie wählte, einen Zugang, sonst würde sie ablehnen.
Und wie ist es, wenn Sie selber eine Rolle in Ihrem eigenen Stück sprechen?
Da bin ich eine Dienst leistende Schauspielerin wie andere auch. Ich muss dann zur Kenntnis nehmen, dass in diesem Moment die Regisseurin zu sagen hat und dass sie mir auch etwas sagen kann. Ich empfinde es übrigens als sehr gelungen, wie Markus Meyer den Hauptpart spricht. Viele Stunden lang war ich ihm als Besucherin des Burgtheaters in einer Shakespeare-Aufführung gefolgt. Zur Finissage am 19.11.2014 wird er ebenfalls auftreten. Ich bin sehr viel selbst performativ live unterwegs, im Augenblick mit Ipek Ipekcioglu, die die türkische Stimme bei „Blumen für Otello“ spricht und den Sound dazu mixt. Es ist etwas ganz anderes, die Bühne in dieser Form buchstäblich auszufüllen, als im Kontext eines Gesamtwerks eine Rolle zu haben.
Lesen Sie Ihre Texte in Lesungen selbst? Das ist ja nicht automatisch das Beste…
Oft können Autoren ihre eigenen Sachen nicht lesen, das ist schade, sehr schade. Ich habe aber Lust am Ton, an der Sprache und an der Artikulation. Das ist einfach schön und macht mir Spaß.
Ist Literatur etwas Szenisches für Sie?
Literatur ist szenisch, ist rhythmisch, ist musikalisch und ist auch Bild. Ich habe das auch im Unterricht schon gesagt: „Machen Sie doch bitte den Mund auf. Sprechen Sie ein A. Das hat so einen wunderbaren Klang. Das müssen Sie doch hören beim Schreiben!“ Einar Schleefs Einreden bei einer Chorprobe wegen des A ist unvergessen. Autoren behandeln ihre eigenen Texte oft wie Müll. Die Dichter und Dichterinnen pflegen da manchmal ein Selbstverständnis vom nach innen gerichteten Selbst, dem es peinlich ist, ins Öffentliche zu treten, und das seine Introvertiertheit pflegt. Das bedient ein überkommenes Bild von einem oder einer, die an Weltschmerz leidet – oder vom Dichter als dem Tuberkulösen, Sensiblen und Unverstandenen. Vielleicht ist das aber auch überinterpretiert, und ich belasse es dabei, dass es Leute gibt, die ihre Texte schlecht lesen.
Sie bearbeiten in Ihren Arbeiten immer wieder die jüdische Thematik – gibt es bei „Partikel vom Großgesichtigen Kind“ auch einen solchen Bezug? Spielt die Assoziation Wien und Juden eine Rolle?
Gerade habe ich darum gerungen – denn es wird bis zur Finissage ein gleichnamiges Buch geben, herausgegeben vom Birkhäuser Verlag in der edition der Angewandten –, wie dieser Punkt in der Ankündigung benannt werden sollte. Das Schicksal jüdischer Personen zu thematisieren, ist ja in dieser Arbeit nicht meine Hauptarbeit; meines Erachtens ist es überhaupt falsch zu denken, jüdische Menschen können überhaupt nur dann vorkommen, wenn sie Hauptpersonen sind. Wir haben jetzt folgende Formulierung für den Klappentext des Buchs gewählt: „…Eine Welt der Anstalten. Nach den Nazijahren. Zum Fürchten. Und wohl zum Fürchten auch der Radiodieb, der in der Anstalt über das Kind zu wachen hatte. Dabei liebte das Kind den Kindermann. Jahre später weiß es die Frau ganz genau.“
Ist es eine Frage des Mutes, literarisch statt journalistisch über aktuelle, gegenwärtige, grausame Themen zu sprechen/ zu schreiben oder gerade nicht?
Naja, wir brauchen die Wissenschaft und den analytischen Blick, aber die Dinge werden durch die wissenschaftliche und analytische Behandlungsweise immer auch entrückt, im wahrsten Sinne des Wortes: ein Stück weiter weggerückt von der Empfindung. Die Wissenschaft zielt ja per se auf die ratio ab. Ich nehme darauf gar keine Rücksicht. Ob das die Vernunft ist (was ich hoffen will) … Wir bestehen eben nicht nur aus Vernunft oder Überlegung. Wir bestehen auch als Körper und Gesamtheit, als Empfindung, ob man das nun Seele nennt… das ist ein anderes Begreifen. Im Zusammenhang der Verbrechen des NSU – Nationalsozialistischer Untergrund – ist es offenkundig, dass die journalistischen und wissenschaftlichen Arbeiten die Dimension des Verbrechens nicht begreifbar machen können, obwohl sie sich darum bemühen.
Ihr Auftrag ist also nicht, kämpferisch und zornig Signale zu setzen?
Nein. Das ist auch gar nicht mein Bestreben. Deswegen muss ich mich ja gelegentlich weiterhin auch journalistisch verhalten. Um eine Nachricht senden zu können, muss ich eben versuchen, alle Sinne und allen Verstand zusammen zu nehmen, um sagen zu können, worum es sich hier handelt, wissend, dass jetzt Leute da sind, die diese Informationen bislang nicht bekommen haben. Das bewegt mich schon, so sehr sogar, dass ich es tun muss. Aber die Sprache, die mir hierfür zur Verfügung steht, ist eine ganz andere als die, die ich als poetische Sprache bezeichne. Bei der poetischen Sprache bin ich fest davon überzeugt, dass das nahe Herantreten – und da halte ich es mit Vladimir Nabokov, der nicht nur Dichter, sondern auch Schmetterlingsforscher und deswegen wahrscheinlich auch Lupenbenutzer war -… dass das nahe Herantreten, um ganz genau zu betrachten, was existiert, vollständig ausreicht, um die Eigenschaften aufzuspüren. Ob etwas furchtbar, kalt oder warm, hässlich oder schön ist. Da sind meine Kommentare, Interpretationen oder Sendungsgefühle vollkommen überflüssig. Die Sache selbst wird durch das Nahetreten etwas zeigen. So denke ich, dass solche Flure, solche Anstalten, solche Treppen, das alte Terrazzo in diesen Gemäuern, die Pflastersteine keiner weiteren Kommentare bedürfen. In der Mathematik ist das, glaube ich, die Betrachtung des Grenzwerts, der gegen Unendlich geht, die Kurven verhalten sich asymptotisch. Ich bin ja so schlecht in Mathematik, aber ich fand es immer spannend, dass es etwas gibt, dem man sich immer weiter annähern kann und trotzdem nie eine Endlichkeit erreicht werden kann. Natürlich gibt es Wertungen, allein durch die Auswahl der Ausschnitte, die ich betrachte.
Warum thematisieren Sie außerdem türkische Minderheiten, wie bei „Blumen für Otello“?
Die Morde in Serie gegen Menschen mit überwiegend türkischem Migrationsbezug, die im November 2011 aufgedeckt wurden, stellen das größte rassistisch motivierte Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland seit ihrer Gründung dar. Dennoch scheint mir eine politische Meinung vorzuherrschen, die Verfolgung aus „rassischen“ Gründen als etwas ansieht, das mit dem Ende des Nationalsozialismus beseitigt worden sei. Solches Handeln ist verboten worden und irgendwie erledigt, und ansonsten gibt es bedauernswerte „Vorfälle“, wo der oder jener zu Tode kommt, oft AsylbewerberInnen.
In diesem Fall handelt es sich um Menschen, die schon seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik, in Deutschland, gelebt haben, die also Nachbarn sind. Das hat noch einmal eine andere Dimension: Dass hier unter den Augen der Beamten eine dreizehn Jahre währende Mordserie stattfinden konnte und die Menschen nicht geschützt wurden, das ist so ungeheuerlich, dass ich alle meine anderen Arbeiten unterbrach und begann, den Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags dazu regelmäßig zu besuchen. Mich bewegte auch etwas anderes. In Deutschland hatte es Jahrzehnte gedauert, bis die Ermordeten der Shoa öffentlich betrauert wurden. Als diese Mordserie offenbar wurde, dachte ich: Nicht wieder Jahrzehnte, bis verstanden wird, dass die Opfer unser aller Tote sind! Deswegen habe ich sofort begonnen, mich damit zu beschäftigen. Mir wurde allmählich klar, dass es hier auch darum geht, eine jahrzehntelang eingeschliffene, falsche Beurteilung darüber, wie relativ weniger bedeutend der Rechtsterrorismus sei, zu korrigieren. Die Unterschätzung dieser Taten und der Reichweite des rechtsterroristischen Netzwerks – das musste unbedingt aufhören. Deswegen habe ich mich damit beschäftigt. An die Stelle der „rassisch“ begründeten Verfolgung ist heute eine ethnisierende Zuschreibung des „Fremden“ gerückt, der mit diesem Furor des „Auszumerzenden“ verfolgt wird. Natürlich stehen mir Menschen, die davon betroffen sind, auch aus persönlichen Gründen nahe.
Was sagen Sie dann aber, wenn Sie äußern, dass das Unterschätzen dieser Tatbestände aufhören muss, zu ganz eindeutigem und bewusstem Niedermachen oder falsch Behandeln von Widerstand gegen Rechtsextremismus, zum Beispiel in Wien beim Akademikerball oder in Dresden bei den Februardemonstrationen?
Das ist ein Grund, warum ich begonnen habe, genauer hinzusehen, wie die Menschen, die gegen die Rechten Widerstand leisten, behandelt werden. Der Rektor der Universität für Angewandte Kunst Wien, Dr. Gerald Bast, wie auch insgesamt das Institut für Sprachkunst, an dem ich lehre, – wir haben mit großem Nachdruck darauf hingewiesen, dass wir diese Demonstrationen für ein zivilgesellschaftliches Engagement halten. Dass sich Leute engagieren und demonstrieren, ist nicht nur ihr Recht, sondern ein Gewinn. Diese motivierten Menschen sind für eine Stadt lebenswichtig. Es ist am Beispiel der jüngst erfolgten Verurteilung von Josef S., der gegen den Akademikerball demonstrierte, auch augenscheinlich, dass eine Gesetzgebung, die auf diese Weise mit dem Landfriedensbruch-Paragraphen umgeht oder umgehen kann, dringend reformiert werden muss. Die Auslegung kann offenbar auch so angewendet werden, dass sie sich gegen die Zivilgesellschaft überhaupt richtet. Wir werden das weitere Verfahren genau beobachten.
Dieser „Umgang“ mit dem Landfriedensbruch-Paragraphen findet aber auch in Deutschland statt…
Wir müssen uns in beiden Ländern mit diesem Straftatbestand Landfriedensbruch beschäftigen, denn er ist offenbar bis ins Unendliche dehnbar. Und er führt zu einer Verkehrung des Demonstrationsrechts, wenn die Beweislast bei dem Angeschuldigten liegt; man also am besten vor Wahrnehmung des Demonstrationsrechts seine Zeugen schon hätte oder eine Kamera-Begleitung organisiert. Das ist absurd. Wir sind ja nur noch dabei zu beweisen und zu verteidigen. Diejenigen zu verfolgen, die dafür eintreten, dass der öffentliche Raum nicht den Rechten gehört, macht die Straßen geradezu frei für die Rechten, die sie besetzen oder besetzen wollen. Es ist ja nicht verhandelbar, wem die Straße gehört, das hat überhaupt niemand zu bestimmen. Nur ist die Wirklichkeit an einigen Orten die, dass die Rechten bestimmt haben und die anderen Leute Angst haben müssen. Ohne die Gegenwehr der Bürger könnte an einigen Orten von selbst bestimmtem Leben keine Rede sein. Ich denke da insbesondere an die gezielte Verfolgung jugendlicher Punks und anderer.
Ist die Macht der Mehrheit vielleicht die kausale Kraft für diese Vorgänge und gar nicht unsere Gesetzeslage bzw. die Rechtsprechung?
Die Mehrheitswahrnehmung nimmt diese Vorfälle häufig zunächst als peripher wahr, als zu irgendetwas anderem gehörig, als etwas, das bestimmte und nur kleine Gruppen betrifft. Da hat die Presse einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass die Bedeutung der Verfahren, die im Zusammenhang mit dem Akademikerball eröffnet werden, klarer wird. Ich fand die Berichterstattung im live-ticker des Standard bewunderungswürdig und war sehr dankbar dafür.
Im Umkehrschluss glauben gelegentlich auch die aktiven Gruppen schon selbst, dass sie peripher seien. Ich hatte den Eindruck, dass sie sich mit der bürgerlichen Mitte gar nicht mehr befassen, weil sie sie aufgeben und auch nicht mehr daran glauben, dass daraus etwas entstehen könnte. Deren Beteiligung ist aber zwingend erforderlich. Deswegen gehe ich für eine Widerrede auch in den Rundfunk und nicht in das Antifa-Feuilleton. Es herrscht in vielen Lagern eine gegenseitige Feindlichkeit, die jede gemeinsame Behandlung solcher Probleme unmöglich macht. Das ist totaler Irrsinn. Was fehlt, ist die denkende bürgerliche Mitte. Als ein Ergebnis aus dieser Fülle von Einzelanklagen müssten verfassungsrechtliche Konsequenzen gezogen und dieser Paragraf müsste abgeschafft werden.
P.S. Sie hatten immer wieder nach Wut gefragt – ich hatte nicht geantwortet. Ich musste Josef S.’ Prozess vorfristig verlassen. Nach monatelangen, über ein Jahr währenden Sitzungen des Untersuchungsausschusses NSU des Deutschen Bundestags konnte ich einfach nicht mehr länger bleiben. Das übersteigt das, was mir möglich ist.