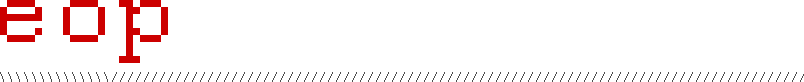Helga Köcher
Buchbeitrag zu
„Friede braucht Bewegung. Analysen und Perspektiven der Friedensbewegung in Österreich.“
Andreas Pecha, Thomas Roithner, Thomas Walter (Hrsg.) Verlag Th. Roithner, Wien 2002.
Wollen wir wirklich alle Gewalt? oder Warum Brücken „ka Gschicht san“....
Wie vielfältig strukturierte Gesteinsmassen gehören die Menschen zusammen zu einer kunterbunten Gesellschaft. Sie brauchen einander, haben gemeinsam größere Lebendigkeit und Kraft. Aber diese tiefe einigende Schichte ist bedeckt von einem Meer von Machtausübung, Geschäft, alltäglicher Betriebsamkeit, Routine, Unterhaltung und vor allem von Ängsten. Zufällig entstandene Berge ragen heraus als größere oder kleinere Inseln. Es scheint, dass sie einander fremd sind, nichts miteinander zu tun haben. Dass sie in ihrer Tiefe zusammenhängen, ist nicht sichtbar. Was, wenn man Brücken zwischen diesen Inseln baut? Brücken für den Frieden?
Das Experiment „Brücken für den Frieden“ hat im Frühling 1999 begonnen, als in Europa wieder einmal Krieg angesagt wurde, obwohl Erfahrene wussten, dass auf diese Art Probleme zwischen Ethnien nie gelöst werden. Die Stimmen derer, die warnten, waren leise, die Stimmen derer, die gewaltsam Ordnung schaffen wollten, waren laut. Wo Platz finden für Zwischentöne, für Fragen, für die geduldige Suche nach Verständnis und für kleine Schritten aufeinander zu? Am besten in den öffentlichen Raum gehen, inmitten der Stadt darüber reden, was geschieht. Für alle sichtbar eine Brücke bauen zwischen den Einen und den Anderen, zwischen Kosovoalbanern und Serben, zwischen Fragenden und denen, die vielleicht Antworten geben könnten, zwischen den wenigen Menschen, die die Verhältnisse ändern wollten und den vielen, die das einfach alles so geschehen ließen.
Ein paar Menschen sind in den Volksgarten gegangen, haben vor dem Theseustempel eine „Brücke des Friedens“ gebaut, Bänke in der Runde zusammengestellt und miteinander geredet. Sie haben Experten, die über große Erfahrung auf diesem oder jenem Gebiet verfügten, eingeladen und sie gefragt. Jeden Mittwochabend sind sie in einer Runde beisammen gesessen, die Bedeutenden und die Unbedeutenden, die einfach so vorbeikamen. Und bald stellte sich heraus, daß die Menschen, die gemeinhin als Publikum bezeichnet wurden, genauso gute Ideen und kluge Ansätze hatten wie die Wichtigen und Prominenten, wenn sie mit diesen in einem Kreis saßen und von ihnen nicht mit langen Referaten zugeschüttet wurden, sondern man/frau einfach miteinander reden konnte. Wie könnte das Entstehen einer Zivilgesellschaft innerhalb verfeindeter Ethnien gefördert werden? Was ist wichtig für den wirtschaftlichen Wiederaufbau? Wie haben sich Menschen aus Friedensbewegungen während dieses Krieges gefühlt? Welche Rolle haben die Religionen in diesem Krieg gespielt und was können sie für den Frieden tun? Wie entsteht die Angst vor Fremden? Halten wir Frieden mit der Natur? Verstehen einander die Alten und die Jungen? Welche Möglichkeiten bietet Neutralität?
Bald wurde in diesen Gesprächen klar, dass alles mit allem zusammenhängt. Dass es nicht mehr ausreichte, die Sache des Friedens und einer menschlichen demokratischen Gesellschaft weiter in kleinen, voneinander isolierten Vereinen und Gruppen mit frommen Appellen zu betreiben, sondern dass Vernetzung erreicht werden müsse. Und die Menschen, die an diesen „Brücken für den Frieden“ bauten, fühlten, dass sie miteinander mehr zu tun hatten als den gemeinsamen Wunsch, in Frieden zu leben. Aus der Freude an diesen Begegnungen entstand Nähe, Freundschaften wuchsen. Zum Einstieg wurde jedes Mal Musik gemacht. Der Abschluss der Serie dieser 15 Gespräche wurde mit einem großen Open Space beim Tempel inszeniert mit Festbeleuchtung, Pop Konzert und Punsch und dabei Ideen entwickelt für die Fortsetzung dieser Brücken in Form von Schulpatenschaften, einer Internetplattform und einem ständigen Diskussionsforum im RadioCafe.
Hörfunkredakteure waren ja die einzigen Medienleute gewesen, die diesem „Brückenbau“ Beachtung geschenkt hatten. Zeitungen hatten dieses zivilgesellschaftliche Labor inmitten der Stadt ignoriert. Den Aktivistinnen und Aktivisten der „Brücken für den Frieden“ war nicht klar warum. Das Filmfestival am Rathausplatz und die Lokale der Summerstage am Donaukanal hatten ihren Platz auf den Wien-Seiten wie jedes Jahr gefunden, auch eine Bonsai-Ausstellung im Esterhazy-Park konnte mit einer halben Seite und Foto Öffentlichkeit für sich gewinnen genauso wie eine schiefe Plakatsäule in eben diesem Volksgarten, die darauf hinwies, dass hier Elfriede Ott als Kind gespielt hätte. Aber dass dieses Terrain den ganzen Sommer über wöchentlich mit hochpolitischen Fragen bespielt wurde wie zum Beispiel der nach den Wurzeln der Fremdenfeindlichkeit, die zur gleichen Zeit eine Wahlwerbung dominierte und einige Wochen später die innenpolitische Landschaft verändern sollte, war von keinem medialen Interesse. Vielleicht weil die VeranstalterInnen der „Brücken für den Frieden“ keine Budgets verbrauchten? War das obszön? Qualifizierte sie das ab?
Die Nationalratswahl 1999 brachte ein problematisches Ergebnis und bitteres Erwachen auf manchen Seiten. Die „Brücken für den Frieden“ setzten ihre Arbeit fort mit einem Jour Fixe an Samstagnachmittagen im Wiener ORF-RadioCafe. Der Start dort war ein Brainstorming „Politisches Unbehagen – was tun?“ Es folgten Workshops zu Integrationsfragen, Diskussionen zur Situation in Tschetschenien, dem Kosovo, den Friedensdiensten am Balkan, zur Struktur des „Brücken“-Netzes, zur Grundsicherung und zur Rolle von Schriftstellern für Demokratie und Menschenrechte. In einem Workshop „Was sag ich jetzt?“ wurden in Rollenspielen mit systemischen Therapeutinnen Argumente gegen fremdenfeindliche Behauptungen geübt. Die Strukturierung von Internetplattformen und Mailinglisten wurde genauso erörtert wie das Thema Konfliktkultur oder die Kommunikationsprobleme zwischen junger und älterer Generation.
Die „Brücken für den Frieden“ hatten sich zu einem systemischen Diskursprojekt ausgeweitet für Alternativen zum neoliberalen Zeitgeist. Eine Begegnung mit französischen ATTAC-Leuten und deren Strategie der Bündelung von Kräften hinterließ nachhaltigen Eindruck. Mit der Veranstaltung eines großen Globalisierungsgesprächs „Wohin führt uns die Globalisierung?“ und dem Coaching der Anfänge durch eine Organisationsentwicklerin aus dem „Brücken“-Team gelang es tatsächlich, die verschiedensten einschlägigen Gruppierungen und Initiativen zu mobilisieren und die Gründung von ATTAC Österreich auf den Weg zu bringen, die sich inzwischen zu einem sehr eindrucksvollen und dynamischen Netzwerk einer Vielzahl lebendiger Gruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten entwickelt hat.
Mit Organisationsberaterinnen sahen wir uns in einer systemischen Aufstellung an, wie es zur aktuellen politischen Lage in Österreich gekommen war. Ein Grundsatzpapier wurde formuliert. „Brücken für den Frieden“ war keine „Wonne-Waschtrog“-Haltung, sondern die Entwicklung von nachhaltigem Widerstand gegen jeden Krieg – den offenen mit militärischen Mitteln genauso wie den verschleierten durch Ausgrenzung, Nationalismus, Rassismus, Rechtspopulismus und Neoliberalismus. All diese Tendenzen bedrohen die Entfaltung von Menschen und Gesellschaften in Freiheit und gegenseitiger Achtung und führen früher oder später zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Friedensarbeit – das konnte nur heißen systemisch zu arbeiten, zu untersuchen, was wirklich geschieht, den Ursachen und Zusammenhängen auf den Grund zu gehen und zu versuchen alternative Lösungsansätze zu entwickeln.
Als Chakteristikum der „Brücken“ hatte sich ein interdisziplinärer Ebenen übergreifender Diskurs zwischen WissenschaftlerInnen, StudentInnen und KünstlerInnen, engagierten Privatpersonen und Mitarbeitern von NGOs herausgebildet. Das Wichtigste an diesem Modell war der emanzipative Charakter: Die hoch qualifizierten Experten hielten keine Referate sondern diskutierten nach kurzen Statements in lebhafter Wechselrede mit Menschen aller Bevölkerungsschichten. Dadurch wurde die Distanz zwischen den einzelnen Ebenen überbrückt und gleichzeitig größerer Realitätsbezug erreicht. Durch die Vielfalt entstand konstruktive Gruppendynamik. Themen wurden kontinuierlich in ihren verschiedenen Aspekten aufgegriffen. Neben Podiums-/Publikumsgesprächen wurden Lösungsansätze für gesellschaftpolitische Fragen durch Einbeziehung von Methoden der Organisationsentwicklung wie OPEN!SPACE, systemische Aufstellung und Appreciative Inquiry angepeilt. Diskutiert wurde lange und gründlich, nicht nur um des Diskutierens willen, sondern auch „damit etwas herauskommt“, konkrete Projekte – Integrationsfeste, Schulpatenschaften, Direktkontakte von NGOs zur größeren Effizienz für Hilfsprojekte, Kunstaktionen, Informationsplattformen, Gespräche mit Entscheidungsträgern, um sie mit Erkenntnissen aus der Praxis zu konfrontieren.
Nachdem die neue Regierung gebildet war, war der ORF nicht mehr bereit, den „Brücken für den Frieden“ Platz im RadioCafe zu geben. Der nächste Ort der wöchentlichen „Brücken“-Gespräche war dann das Lokal „Alte Ambulanz“ im Uni-Campus. Im November 2000 wurde im Selbstverständnis als gesellschaftspolitisches Labor zur Entwicklung horizontaler Strukturen eine Kooperation mit Pierre Bourdieu’s europäischem Diskursprojekt „Raisons d’agir“ vereinbart. Gleichzeitig verloren die „Brücken“ neuerlich ihr Quartier und auch der nächste Ort, das „Depot“ im Museumsquartier bis zum April 2001 konnte nur ein kurzfristiger sein. Das Management des neuen Museumsquartiers beantwortete die Anfrage der „Brücken“ nicht einmal. Dort wie an allen öffentlichen Orten sind seit längerem Menschen, die im geduldigen Gespräch miteinander nach Wegen in die Zukunft suchen, dem finanziellen Druck ausgesetzt. Stattzufinden hat nur, was etwas „einspielen“ kann. Die Demokratie behauptet, sich einen freien Ort der Begegnung nicht mehr leisten zu können. Zeit, Zwischenbilanz zu ziehen. Was sind die Erfahrungen der „Brücken für den Frieden“?
„Brücken“ ermöglichen Begegnung und die Begegnung bringt Erfahrung – Erfahrung des Gemeinsamen wie Erfahrung der Differenz. Der Differenz, die immer wieder als trennend definiert wird, obwohl sie so konstruktiv ist: An Differenz kann die eigene Identität fruchtbarer und tiefer gehend konstituiert werden als am Kontakt mit Gleichem. Wenn der Brückenprozess richtig angegangen wird, behutsam, neugierig, beharrlich, oszillierend zwischen dem Blick auf das Eigene und das Andere, respektvoll und unvoreingenommen, mit ungetrübtem Blick auf das, was auf der anderen Seite der Brücke wirklich wahrgenommen wird, dann stellt er die eigene Identität nicht in Frage, sondern diese wird im Gegenteil klarer und sicherer.
Oft genug aber wird Identität selbst von denen, die die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern wollen, nicht aufgebaut aus dem Prozess der Begegnung mit dem Anderen, dem Blick auf das Eigene aus der Verarbeitung der Differenz, sondern noch immer weitgehend über eine möglichst homogene Gruppe. Die definiert ihre Identität über gemeinsame Ziele und Strategien und oft auch Eigenschaften, was mit der Abwertung anderer Gruppen verbunden ist. Sie kämpfen gegen Ungleichheit und wollen selber gleich sein. So gesehen werden Brücken als überflüssig bis suspekt oder gar störend empfunden. Unter sich ist man ohnehin gut und sieht sich im Besitz der Wahrheit. Aber dieser aus der prähistorischen Horde geborene homogene Gruppenbegriff hat längst ausgedient. Die nach seinen Regeln Agierenden konnten die Kriege des letzten Jahrhunderts nicht verhindern, weil dieser Gruppenbegriff ein hierarchischer ist, der die Machtstruktur der Seite der Gewalt spiegelt.
Die wesentlichste Barriere gegenüber einer friedlichen Entwicklung ist die Scheu vor Emanzipation. Es fällt Menschen ungeheuer schwer, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und ihre Interessen zu vertreten. Viel lieber orientieren sie sich an einem „Führer“, lassen sie sich manipulieren – von einer Clique, von Eliten oder Idolen, von einem Modetrend, vom herrschenden Zeitgeist…. Es war irritierend, diese Tendenz auch unter den Engagierten, unter den Protestierenden, unter den DemonstrantInnen gegen Krieg, Faschismus, Diktatur und Übergriffe zu finden, erkennen zu müssen, dass auch diese Menschen lieber hinter einer Fahne marschieren, statt koordiniert an konkreten Projekten und Aktionen zu arbeiten. Die „Brücken für den Frieden“ waren auch ein Feld der Erkenntnis dafür, wie groß die Scheu ist, sich wirklich in einen Prozess einzuklinken, um wie viel lieber auch in der Szene der Engagierten man/frau den großen Namen lauscht, anstatt sich mit seines/ihresgleichen zusammenzusetzen und die Dinge konkret in Angriff zu nehmen.
Die „Brücken“ haben aber gezeigt, wie inspirierend es sich auf jene Mutigen auswirkte, die tatsächlich beginnen, sich als Mitakteure zu begreifen statt als Publikum. Menschen, die den Frieden wollen und nicht steinzeitliche Abgrenzungen und Auseinandersetzungen – von verbalen bis zu nuklearen – beginnen endlich, von den Erkenntnissen der Wissenschaft zu lernen, der Unschärferelation, der Quantenphysik, der Chaostheorie, der Systemtheorie. Sie nehmen sich ein Beispiel an die effizienten Strategien der kleinsten Lebewesen. Sie haben sich in die Köpfe und in die Herzen von Menschen eingeschleust, die eine friedliche, menschliche, gerechte Welt wirklich wollen und nicht bloß ihre eigene Identität stiften. Die fangen nun an „Brücken“ zu bauen. Sie beginnen Netzprojekte mit anderen Gruppen, weichen die Mauern, die ihre Gruppe identitätsstiftend umgeben hatten, kreativ auf und funktionieren sie zu Kontaktbereichen der Begegnung und des Gesprächs um. Und wunderbarerweise entdecken sie an diesen Kontaktbereichen ähnliche Ziele, entwickeln koordinierte Strategien und beginnen schließlich gemeinsam zu handeln. Die sich nun koordinierende Neutralitätsbewegung ist ein solches Feld. Das eindrucksvolle Netzprojekt ÖSTER-REICH FÜR ALLE GLEICH ist ein anderes.
Beim Projekt „Demokratiezelt“ geht es um die Entwicklung des neuartigen Modells einer arbeitsteiligen Kooperation von Ebenen verschiedener gesellschaftlicher Position und Funktion und daher auch verschiedener Kompetenz, die das gleiche Ziel haben: Die Belebung der demokratischen Kultur und Partizipation durch die Schaffung und Betreibung einer Art öffentlich zugänglichen demokratischen Forums. Die Realisierung dieses Projekts würde den verschiedenen zivilgesellschaftlichen Netzwerken die Räume und und die potente Unterstützung in Form von Infrastruktur geben, die sie brauchen, um wirksam zu werden. Inzwischen wird für September eine neue Visionale, eine Messe der Zivilgesellschaft in Wien vorbereitet. Es boomt ATTAC Österreich und wird in zahllosen Aktionen und Veranstaltungen aktiv. Europaweit werden immer mehr ATTAC-Netzwerke gegründet – vor kurzem haben sich ATTAC Schweden und ATTAC Finnland konstituiert.
Aber noch immer interessiert das alles die Medien kaum. Sie beklagen zwar das Umsichgreifen von Gewalt, aber sie negieren, dass das Medium TV die mit Abstand umfangreichsten Sendezeiten der „Werbung“ für die Figur der Gewalt und der gewaltsamen Lösungen einräumt. Die mediale Empörung über Ausschreitungen nimmt oft genug den Charakter von Verhetzung an. Kommentatoren von Qualitätsmedien kritisieren mehr und mehr die unterentwickelte Zivilgesellschaft und die unterentwickelte Debattenkultur. Wenn Menschen aber versuchen, der Wurzel von politischen Missständen auf den Grund zu gehen, wird das als ihr privater Luxus betrachtet. Die öffentliche Beschäftigung mit Inhalten ist das Privileg dazu Befugter. Die Nicht-Befugten dürfen allenfalls (kurze) Fragen stellen – und alle paar Jahre zur Wahl gehen.
„Öffentlichkeit“ hat einen merkwürdigen Bedeutungswandel genommen: Medien verstehen darunter nicht mehr das, was in der Öffentlichkeit stattfindet, sondern öffentliche Macht, Aussagen und verbale Entgleisungen „öffentlicher Personen“ und tatsächliche oder behauptete öffentliche Bedrohung. Wenn Proteste nicht zu gewalttätigen Entgleisungen führen, werden sie verschwiegen (mit Ausnahme der Fälle, in denen es außenpolitischer Konsens ist, darüber argumentativ zu berichten). Alles, was nicht in irgendeiner Weise katastrophal oder chaotisch ist, ist für die Medien nicht berichtenswert. „Des is ka Gschicht“ ist die stereotype Antwort von „Medien-Verantwortlichen“. Tot-Schweigen heißt die mediale Antwort auf alles, was sich zivilgesellschaftlich regt – so lange bis etwas zu Bruche geht, brennt, womöglich Blut fließt. Dann ist es zwar kriminalisiert, aber wird wahrgenommen. Wen wundert da Göteborg? Der Staat selbst zieht sich mehr und mehr aus den Bereichen seiner Verantwortung für die Gemeinschaft zurück in Reduktion auf sein Gewaltmonopol. Wen wundert da die Entfremdung von ihm?
Die „Brücken für den Frieden“ würden gern untersuchen, welche Auswirkungen das auf Demokratie und Wahlverhalten hat. Würden gern den Unterschied zwischen Demokratie und Oligarchie thematisieren. Würde gern die Frage „Was ist Faschismus und was ist Aufarbeitung?“ aktuell in ihrem gesamten Umfang stellen und die „Wie weit reicht Europa nach Osten?“ statt einer Abstimmung einem breiten Diskurs zuführen. Den faulen Trick beleuchten, erwünschte Haltungen zu Themen von oben über Massenmedien zu kommunizieren und die Ergebnisse dieser Manipulation dann als Ergebnis von Meinungsbefragungen zu publizieren. Irgendwo müssten doch auch „Verantwortliche“ sitzen, die diese Zusammenhänge begreifen und bereit sind, an „Brücken für den Frieden“ mitzubauen. Straft nicht Reality-TV das Argument Lügen, es sei „ka Gschicht“, wenn Menschen reden?