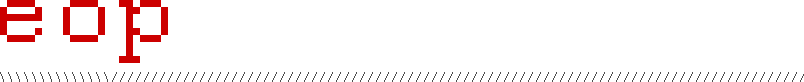„In:visible“ – Ich sehe was, was Du nicht siehst. Dokumentation
einer choreographischen Ausstellung (Simon Frearson/Daniel Aschwanden)
© Rebecca Schönsee, Februar/März 2004
Eine Möglichkeit, „In:visible“ zu transkribieren wäre folgende: „In der Ausblendung spiegelt sich das Ich. „In:visible“. Der Doppelpunkt symbolisiert die gebrochene Linie zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit in Bezug auf Raum, Person und Zeit, im white cube und seinem Außerhalb. Konsum und Leere sind die Hauptthemen des vorliegenden Stückes von Daniel Aschwandens und Simon Frearson unter dem Motto. „Ich sehe was, was Du nicht siehst“. Um das „In“ „visible“ zu machen, bevölkern für eine Stunde in ihren Körpern behinderte und nicht-behinderte Darsteller die Bühne des Tanzquartiers.
Die geheimnisvoll unklare Hülse, die uns jeder TV-Moderator nach dem anderen täglich zu wirft: „Machen sie’s gut“, scheinen Daniel Aschwanden und Simon Frearson sowie alle Mitwirkenden aufgegriffen zu haben. In der TV-Moderatoren Welt, dreht sich alles ums Vergnügen. Multisensitiv, spannend, einmalig müssen sie sein, die Ereignisse oder Events, die unsere Begehrlichkeiten wecken. Wohl kaum einer würde sich darunter eine choreographische Ausstellung vorstellen. Und dennoch – Es war multisensitiv, spannend, und vor allem einmalig. Jeder Abend war anders. Eben kein Event der Reproduzierbarkeit. Den Slogan „Machen Sie’s gut“ haben die Gruppe Bilderwerfer auf eine Reise geschickt und interpretiert: “Kunst war los im Tanzquartier!“
Eine andere Möglichkeit, mit der choreographischen Ausstellung umzugehen, wäre es, sie als unsichtbaren Text zu präsentieren und zu dokumentieren. Den open space weißen Papiers, den ich gerade vor mir sehe, also so zu lassen wie er ist. Der Besucher dieser Ausstellung wird durch das Programmheft in eine ähnliche Ausgangssituation gebracht wie die eines Textentwurfs.
Ein weißes Papier ist zu entfalten, in dessen Inneren der erfrischend kurze Text zu lesen ist: „If you could see with your eyes what I have seen“. Diese Frage an den Ausstellungstext mag manch einem wie eine Thematisierung von Wittgensteins Privatsprachenargument vorkommen. Ein Anderer hat das Papier vielleicht einfach nur entfaltet und zurückgefaltet in seiner Privatassoziation. Beide waren aber durch diese Aktion sofort in der Ausstellung, die genau dieses Entfalten des „ich sehe was, was Du nicht siehst“, leistet.
Für diese Dokumentation wie für ihren Gegenstand, die Performance selber, gilt, noch bevor sich die Leere füllt: Das Sprachspiel hat begonnnen – „If you could see what I have seen with my own eyes“ entschlüsselt sich als ein Leitsatz, der helfen soll, Sehmechanismen zu verdeutlichen und Sehkonsumgewohnheiten zu brechen.
Dem Konsumismus der 60er Jahre setzte Judd den White Cube im Kunstbereich entgegen. Kein Detail durfte den reinen White Cube stören, in dem ein „specific object“ stand. „Sein Projekt zeigte aber auch, dass in keine Sphäre der Kunst, wie konzpetuell auch immer, nicht doch die heißhungrige Gegenwart mit ihrem universalen Verwertungsanspruch eindringt.“ (Liebs,Holder, Süddeutsche Zeitung 6.2.2004) Daniel Aschwanden und Simon Frearson unterlaufen diesen Gegenwartsbezug in ihrem Projekt „In:visible“, indem sie ihn erst gar nicht erst zu negieren versuchen. Der Besucher wird im Betreten ihres Raums sogleich als Teil einer theatralischen „Situation“ erfasst. Diese verdoppelt sich, weil der „white cube“ ins Tanzquartier platziert wird, genauer gesagt auf die Bühne.
Die Bühne wird Ausstellungsraum, die Besucher werden Darsteller. Die Trennlinien zwischen Kunstkonsument, Konsument und Darsteller werden aufgehoben. Auch hier wieder im doppelten Sinne, denn wer den Mut hat, aus der Rolle eines Tanzquartierbesuchers zu fallen, bzw. bewusst das Klischee zu brechen, wird schon vorher kräftig mit Popkorn versorgt. Im „Kino“ kann man dann seinen Nachbarn beim Kauen, beim Starren, beim Sehen betrachten. Schon an dieser Stelle wird also der Drang nach den „falschen Bedürfnissen“ (Marcuse) Objekt der Betrachtung.
Das Popkorn suggeriert Kinoerlebnis, aber der „white cube“ erzeugt einen Filmriss. Hier wird das Unsichtbare sichtbar gemacht. Das unsichtbar Sichtbare, in dem wir uns unbewusst immer schon befinden, ist hier die räumliche Situation. Der Zuschauerraum ist abgetrennt, das Geschehen vollzieht sich auf der Bühne. Gespenstisch groß und leer liegen also die Stuhlreihen, die Tribünen da, ein off-space, der den Zuschauer in seine Magie hinein nimmt. Genau über diesen magischen Raum betritt er die Bühne.
Eine andere unsichtbare aber präsente Komponente ist der Zeitraum vor und nach dem Ereignis – der Entstehungs- und der Nachbereitungsprozess. In Workshops wurden die Abende erarbeitet, währenddessen der Betrachter immer mehr zum unsichtbaren aktiven Partner wurde. Die Rollenverteilungen schmelzen. Die Darsteller sind als Laien gleichfalls Besucher. Und so heißt es dann vor der Premiere um 20:35: „Es sieht so aus, als ob wir Einlaß machen müssten.“
Sich gegenseitig beim Eintritt zu erspähen, hat besonders bei der Premiere einen eigenen Thrill, immerhin erspäht man auch die Rollen der Besucher, den Kritiker, die Tanzquartier Chefin, den Fotografen, und all die anderen, deren Alltags-Ichs „invisible“ bleiben. Für die nächsten 60 min. werden sich alle denselben mental space teilen. Es kann beginnen. Spaced-out stehen die Darsteller anfangs arbiträr im Raum. Es sind zum größten Teil Laiendarsteller, Behinderte und Nicht-Behinderte, die sich zu dieser choreographischen Ausstellung zusammengefunden haben.
Die anfängliche Ruhe gibt Zeit, die Körper wie Skulpturen zu betrachten. Eine tief herabhängende weiße „Leinwand“, die den Raum der Bühnenaufbauten ausspart, spiegelt den weißen Boden, indem sich gleichfalls in weiß gekleidet die Darsteller befinden. Dem Besucher ist der schwarze Rand außerhalb des weißen Raumes zugeteilt. Hin und wieder stechen die roten Popkornbehälter heraus. Das erinnert stellenweise an einen U-Bahn Schacht. Gleichfalls eine Situation des Beobachtens. Der „Tunnelblick“ wird aber konsequent gestört, es ist eben als choreographisch Ausstellung zu verstehen, die gemäß dem Namen eines Teils der Truppe, Bilderwerfer, Bilder wirft: Bewegte Standbilder – tablaux vivants. Als Folge des stillen Anfangsbildes fokussiert das Auge des Betrachters erst langsam das Detail.
Zunächst trifft auch hier auf den ersten Blick zu, was Pasolini von seiner Reise in die Sowjetunion 1978 berichtet: „Was am meisten beeindruckt, wenn man durch eine Stadt in der Sowjetunion geht, ist die Gleichförmigkeit der Menge: man bemerkt kaum einen Unterschied zwischen den einzelnen Passanten, in der Art, wie sie gekleidet sind, wie sie gehen, in ihrer Art, ernst zu sein, zu lachen, sich zu bewegen, kurz: in ihren Handlungsweisen.“ (Pasolini, Pier Paolo: Freibeuterschriften. Berlin 1978 S. 36)
Aber die Gleichförmigkeit täuscht: Zwar mag die Verpackung des Verzehrten und der Gegenstand des Konsums gleichförmig sein, die eigene Oberflächenstruktur des Monochroms wird aber sehr wohl durch die „feinen Unterschiede“ (Bourdieu) strukturiert. Monochrom weiß wird Multichrom. In diesem adaptierten White Cube richtet sich die „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ auf den tatsächlichen Leib, der mit sichtbaren und unsichtbaren Einschränkungen präsentiert und erfahren wird.
Wenn nach einer Sequenz in gedämpftem Licht, plötzlich das weiße Licht voll angeht, fühlt sich wohl so mancher nicht allein davon geblendet. Denn die Konfrontation mit der Behinderung setzt auch eine Konfrontation mit inneren Ängsten frei.
In einer Sequenz werden den Darstellern Ausschnitte eines sehr frühen Horror/Zombiefilms auf die Rücken projiziert. Der Körper funktioniert als Leinwand. Auf den Körpern landen Körperdetails der Filme – ein weit aufgerissenes Auge, eine Hand, ein Mund – Im Gegensatz zum Film, der Angst künstlich produziert, erreicht die Erfahrung dieses Projekts, Ängste zu nehmen. Denn die Choreographie rollt und alle rollen mit, unabhängig ihres Körpers oder gerade mit ihrem Körper.
Das Stück basiert größtenteils auf Improvisation. Auf Initiation mutiert einer nach dem anderen zum Zombie, was bei den meisten sichtbar wird durch ein Heben der Arme auf Brusthöhe. „If Go is a DJ – life is a dancefloor“ ist seit einigen Monaten ein „Hit“, der gebetsmühlenartig ein Rauscherlebnis à la „arms in the air“ propagiert. In den kurzen Disco Sequenzen, in denen es jedem Darsteller erlaubt ist, seinem Disco Trott nachzugeben und je nach dem voll aus sich rauszugehen oder am Platz von links nach rechts zu wippen, wird diese Bewegung gespiegelt und als Zombieaktion entlarvt. Lustig, wie einige Zuschauer mitwippen.
Ob Erfrischungsgetränk oder Musik: Beide kommen aus der Konserve, und der Konsum passiert im Beat. Hier entsteht aber auch Komik. Der Verzehr eines Schokoriegels zu Mitte oder eines Erfrischungsgetränks am Ende des Stückes hat immer Lacher auf seiner Seite. Die Darsteller zelebrieren hier einen „Glücksmoment“ der Kulturindustrie, deren Versprechung bei keinem auf taube Ohren stößt. Kurz weckt die Darstellung dieses Versprechens Neidgefühle. „Ich will auch“. Das Haben-Wollen wird geweckt und löst sich im Lachen.
„Invisible“ bleibt bei den passiven Zuschauern die dazu gehörige Bewegung: Das wäre ein weiteres die Hände nach etwas ausstrecken. Im Stück entwickelt sich eine optimistische Ebene der Bewegung des Armeauststreckens, wenn am Ende alle aus einem Art Traumzustand erwachend, in den sie der Verzehr des Schokoriegels versetzt hat, blind aufstehen und durch den Raum gehen, wobei sie die Arme des Tastens wegen heben.
Kontakt wird sichtbar bewusster erlebt: Eine Rückkehr aus dem Frommschen Habens-Modus in den Seins-Modus. Dieses buchstäbliche Darstellung des Invisible ist der Höhepunkt der Ausblendung. Nicht mehr Konsum, sondern die bewusste Berührung dominiert. Diese Szene wird damit zum größtmöglichen Kontrast zur Eßbewegung des Popkorns. Während sich einige Betrachter also mit weißer, aufgeblasener Masse auffüllen, also passiv fast zwanghaft konsumieren, besteht der Parallel – Konsum eben nicht in einer weiteren Ersatzbefriedigung aus Hollywood, sondern in der sich abendlich ändernden Choreographie.
Es geht gar nicht darum, ob es „einen „richtigen Film“ im „Falschen“ gibt. Bei „in:visible“ geht es um die Ehrlichkeit des Eigenen. Jeder Darsteller ist frei, zu tun und lassen was er will. Zwar existiert ein Rahmen. Ehrlichkeit erfordert aber auch die Freiheit, den Rahmen zu brechen, wenn es z.B. die Behinderung nicht erlaubt, dem choreographischen Muster zu folgen. Das führt zu ganz eigenen Momenten. So wenn ein Darsteller minutenlang am Boden kauert während all anderen schon längst in Discotrott verfallen sind. Oder eine Darstellerin mitten im Stück zu weinen beginnt. Natürlich bleibt die Behinderung ein Stigma. Damit umzugehen ist eine große Aufgabe, die wortlos in solchen Passagen diskutiert wird.
Am Ende bleibt die Mitte frei, alle stehen am Rand. Ein Schlachtfeld von Schokoriegeln Verpackungen und Dosen bleibt zurück. Es ist ein trauriges Bild der Konsumschlacht. Mit meiner Popkornturmverpackung gehe ich nach Hause. Ein Souvenir.
If you could see with your eyes what I have seen…